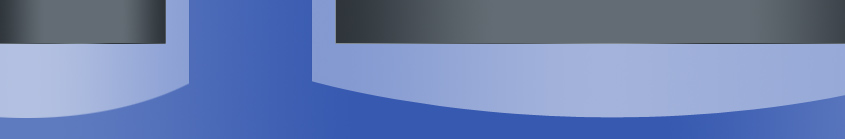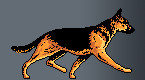


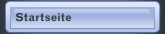 |
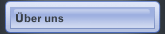 |
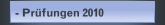 |
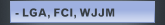 |
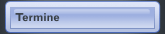 |
 |
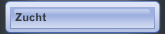 |
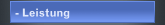 |
 |

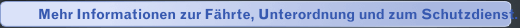
Fährte:
Der
Erfolg einer jeden Heranziehung von Hunden zum Hilfsdienst des Menschen
ist an erster Stelle abhängig von der sachverständigen Führung, die den
Hund richtig einsetzt und so mit des Hundes Eigenart vertraut ist, dass
sie die von ihm gegebenen Zeichen richtig zu deuten versteht.
Max von Stephanitz
Warum Fährtenarbeit?
Kein Mensch kennt den Geruch von Kochsalz. Ein Deutscher
Schäferhund kann den Geruch des Alltagsgewürzes noch in einer
Verdünnung von 1:10.000 mit der Nase herausfiltern.
Dies ist nur ein Beispiel für den außerordentlichen Geruchssinns der
Vierbeiner, mit denen wir zusammenleben. Um dem Hund, der diesen
Geruchssinn vom Stammvater, dem Wolf, geerbt hat und der auf der Anatomie
der Nase des Hundes beruht, eine Gelegenheit zu geben, ihn auch zu
gebrauchen, üben wir das Fährtensuchen mit unseren Hunden.
Der Hund lernt entweder, umherfliegende Geruchspartikel eines
Vermissten (wie das die Rettungshunde tun) aufzuspüren oder, wie es bei
uns der Fall ist, dem Verwesungsgeruch der Kleinstlebewesen im Boden zu
folgen, die wir beim normalen Gehen über eine Wiese etc. hinterlassen.
Hierbei spielt der Fährtenleger keine Rolle, der Hund ist aber nach
vielem Training in der Lage, ältere Fährten von jüngeren Fährten zu
unterscheiden.
In den Prüfungsordnungen werden nicht nur die Länge der Fährte
vorgeschrieben, sondern auch die Anzahl von Winkeln und Gegenständen,
die der Hund auf der Fährte verweisen muss. Ebenso wird die Zeit
angegeben, die die Fährte "liegt", bevor Hund und Hundeführer sie
absuchen dürfen. Man sagt im Allgemeinen, dass der Geruch für den Hund
nach 10 Minuten am intensivsten ist.
Das Gelände, auf dem die Fährten gelegt werden, ist nie geruchsneutral,
jeder Boden hat seinen eigenen spezifischen Geruch. In der Prüfung als
zulässig gelten Waldboden, Wiesen und Äcker, in der Praxis wird aber
durchaus auch auf Schotterhalden, Deponien oder betonierten Flächen
gesucht, was natürlich besondere Übung voraussetzt.
Die Gegenstände können aus Leder, Kunstleder, Textilien oder Holz sein
und sollen eine Größe von max. 10cm x 3cm x 1,5cm nicht überschreiten.
In der Praxis werden aber durchaus auch Patronenhülsen oder Münzen vom
Vierbeiner gefunden.
In unserer Ortsgruppe wird die Fährtenarbeit durch Motivation entweder
mit Leckerchen oder auch durch Belohnung mit Spielen geübt. Die Fährtenarbeit ist
Fleißarbeit, was uns dazu veranlässt, gemeinsam jeden Sonntag um 10 Uhr
in die Fährte zu gehen. Trotzdem ist es ratsam, diesen Teil der
VPG-Ausbildung mehrmals wöchentlich zu trainieren, weil der Hund (und
auch der Mensch) nur so zu einer konzentrierten und routinierten Arbeit
gelangen kann. Die gemeinsame Fährtenarbeit einmal wöchentlich ist sehr
wichtig, weil oft nur von Außenstehenden Fehler erkannt werden, die
sich beim Team, das ständig allein arbeitet, mit der Zeit eingeschlichen
haben. Auch ist es bei vielen Hunden wichtig, unter Ablenkung zu
trainieren, um optimal auf die Prüfungssituation vorbereitet zu sein.
Die Fährtenarbeit ist im Grunde für alle Rassen, egal ob groß oder
klein, eine geeignete Beschäftigungsmöglichkeit. Voraussetzung ist,
dass der Hund seine Nase gerne einsetzt. Für die
Fährtenhundprüfung ist die Begleithundprüfung die Voraussetzung, die
man ebenfalls mit Hunden aller Rassen ablegen kann (siehe
Unterordnung).
 | |
Unterordnung: Den Charakter eines Menschen kann man nach der Behandlung beurteilen, welche er den Tieren angedeihen lässt. Friedrich der Große Warum Unterordnung? Das Geheimnis jeder Ausbildung hat schon Max von Stephanitz (der Gründer des SV) 1921 formuliert: Es beruht "auf richtigem Erkennen und Verwenden vorhandener Anlagen". Ausserdem kann man sich zunutze machen, dass das Rudeltier Hund dem Alphatier Mensch als Sippenführer gehorchen will. Aber der Hund ist keine Maschine, sondern ein lebendes Wesen mit eigenen Trieben. Jeder Hund ist ein Individuum, deshalb kann es auch niemals die eine, immer funktionierende Ausbildungsmethode geben. Man muss sich bei jedem neuen Hund wieder neue methoden ausdenken, Methoden mischen usw. Gerade daran liegt der Reiz an der Arbeit mit dem Hund. Der Zeitpunkt der Ausbildung und der Erziehung beginnt quasi mit der Geburt des Hundes. Ab dem Moment, wo der Hund das Licht der Welt erblickt, wird er durch die unterschiedlichen Umwelteinflüsse geprägt. Allerdings muss auch der Beginn der eigentlichen Ausbildung sehr individuell betrachtet werden. Bei dem einen Hund sollte man sehr früh beginnen, der nächste braucht möglicherweise für eine gute Entwicklung noch etwas Zeit. Der Hund lernt frei neben dem Fuß zu gehen, die Kommandos Sitz, Platz, Steh; außerdem das Apportieren von Gegenständen auch über Hürde und Kletterwand, etc. Diese Übungen stellen keine Kunststückchen da, die der Hund zur Belustigung des Menschen lernt, sondern sollen Hund und Mensch auch ermöglichen, im täglichen Umgang stressfreier zu Leben. Hier ist es wohl wichtig zu erwähnen, dass die Begleithundeprüfung (die aus einem Unterordnungsteil und einem Wesenstest besteht) nicht nur Voraussetzung für spätere VPG-Prüfung ist, sondern auch für die Teilnahme an Agility-Turnieren und Fährtenhundprüfungen. Im Übungsbetrieb unserer OG wird in allen Sparten sehr auf das Individuum Hund geachtet. Aber gerade bei der Unterordnung darf man auch den Faktor des "Individuums Mensch" nicht außer Acht lassen. So wie man nicht jede Ausbildungsweise beliebig auf jeden Hund übertragen kann, ist auch nicht jede Methode für jeden Hundeführer geeignet. Grundsätzlich bilden wir über die positive Bestärkung aus. Ob dies nun auf der Basis von Beutespielen oder Leckerchen als Belohnung läuft, ist dann wieder für jedes Team (und auch für die verschiedenen Ausbildungsstadien und von der jeweiligen Übung) unterschiedlich. Wir gehen dabei davon aus, dass richtiges Verhalten belohnt, falsches Verhalten ignoriert wird. Damit Mensch und Hund gut lernen können, muss die Umgebung möglichst stressfrei sein und die Arbeit sollte beiden Partnern Spaß machen. Dies ist gerade bei der Unterordnung sehr wichtig, denn es gibt nichts schöneres als wenn ein Hund eine schöne, sichere Unterordnung mit Spaß macht! |
 Schutzdienst: Dass bei einem so betätigungsfreudigen Hunde wie unserem Schäferhund, da, wo keine dienstliche Verwendung stattfindet, der Spieltrieb bis ins hohe Alter rege bleibt, ist nicht erstaunlich: Spiel ist eine Vorbereitung auf den Ernst des Lebens. Max von Stephanitz | |
| Warum Schutzdienst?
Gerade der sportlich aktive, im Schutzdienst sichere und energische Hund zeigt sich Menschen gegenüber als gutartig und friedlich. Er kann sich im Schutzdienst-Sport austoben- und das schafft die Ausgeglichenheit, die sich ein jeder Besitzer von seinem Hund wünschen sollte. Um mit den Vorurteilen gegenüber der Schutzdienstarbeit, wie sie ja gerade heutzutage in der Regel sind, aufräumen zu können, sollte klargestellt werden, dass der Schutzdienst nicht dazu dient, bestimmte Aufgaben ("Schutzaufgaben") mit Hilfe des Tieres zu erledigen. Weder die Ausbildung noch der Sport selbst stellt eine Gefahr für Andere dar. Begriffe, die in der Schutzdienstausbildung häufig benutzt werden sind Trieb, Stärke und Belastbarkeit. Diese Begriffe beschreiben die Eigenschaften eines Hundes, die jeder Hundeführer berücksichtigen muss. Der Trieb beschreibt hierbei die Freude an der Auseinandersetzung, am Kampf. Dies sollte nicht mit "Aggression" oder "Schärfe" verwechselt werden. Stärke meint die Selbstsicherheit des Hundes in kritischen und gefährlichen Situationen und die Fähigkeit, eine Situation nicht bedingungslos und wahllos auf eine andere zu übertragen. Mit Belastbarkeit ist sowohl die physische als auch die psychische Belastbarkeit gemeint. Die Fähigkeit, Belastungen zu ertragen, ohne "umzukippen", also ohne in aggressives, z.B. angstbeisserisches Verhalten zu verfallen. Nur wenn der Junghund diese Eigenschaften besitzt, ist er für die Schutzhundausbildung geeignet. Die Ausbildung beschränkt sich in unserer Ortsgruppe auf eine Beuteausbildung. Hierbei beginnt man mit dem jungen Hund mit dem spielerischen Kampf um einen Jute- oder Lederlappen (ein altes Handtuch tuts auch).Im weiteren Verlauf wird der Sack durch eine Beißrolle ersetzt, später dann durch den Ärmel. Dabei wird die ganze Zeit darauf geachtet, dass die Beute für den Hund immer im Vordergrund steht und die Aggression auf die Person hinter der Beute nicht zu stark wird. Eine gewisse Aggression des Hundes gegenüber dem, der die Beute streitig macht, ist dabei allerdings nur natürlich. Der Hund befindet sich während des Schutzdienstes in einer sehr hohen Trieblage. Wichtig ist jetzt, ihn trotz dieser hohen Trieblage unter Kontrolle zu halten. Hier kommen nun die Gehorsamsübungen ins Spiel. Damit der Hundeführer jederzeit in der Lage ist, den Hund von der Beute abzurufen, ist konsequentes und liebevolles Arbeiten von nöten. So entsteht durch die äußerst intensive Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier ein Team, bei dem sich beide Partner bedingungslos in jeder Lebenslage auf den Anderen verlassen können. Man muss nochmal wiederholen: im SV wird nicht mit unsicheren, wesensschwachen oder von Natur aus zu Aggressionen neigenden Tieren gearbeitet. Vor einer jeden Prüfung (und auch vor Beginn einer jeden Ausbildung) wird der Hund auf die Festigkeit des Wesens getestet. Die Arbeit mit dem Hund (und das gilt für alle Sparten der VPG-Ausbildung) soll dazu dienen, dem Hund zu ermöglichen, seine angeborenen Triebe kontrolliert auszuleben. Was wir also erreichen wollen ist der ausgeglichene, wesensstarke Hund, der in jeder Lage von seinem Führer kontrollierbar ist und dabei aufgrund von gewissenhafter Ausbildung ein eigenes Urteilsvermögen besitzt. Menschen, die ihre Hunde zu ungesicherten Waffen machen wollen, sind in einer SV-Ortsgruppe fehl am Platz! |